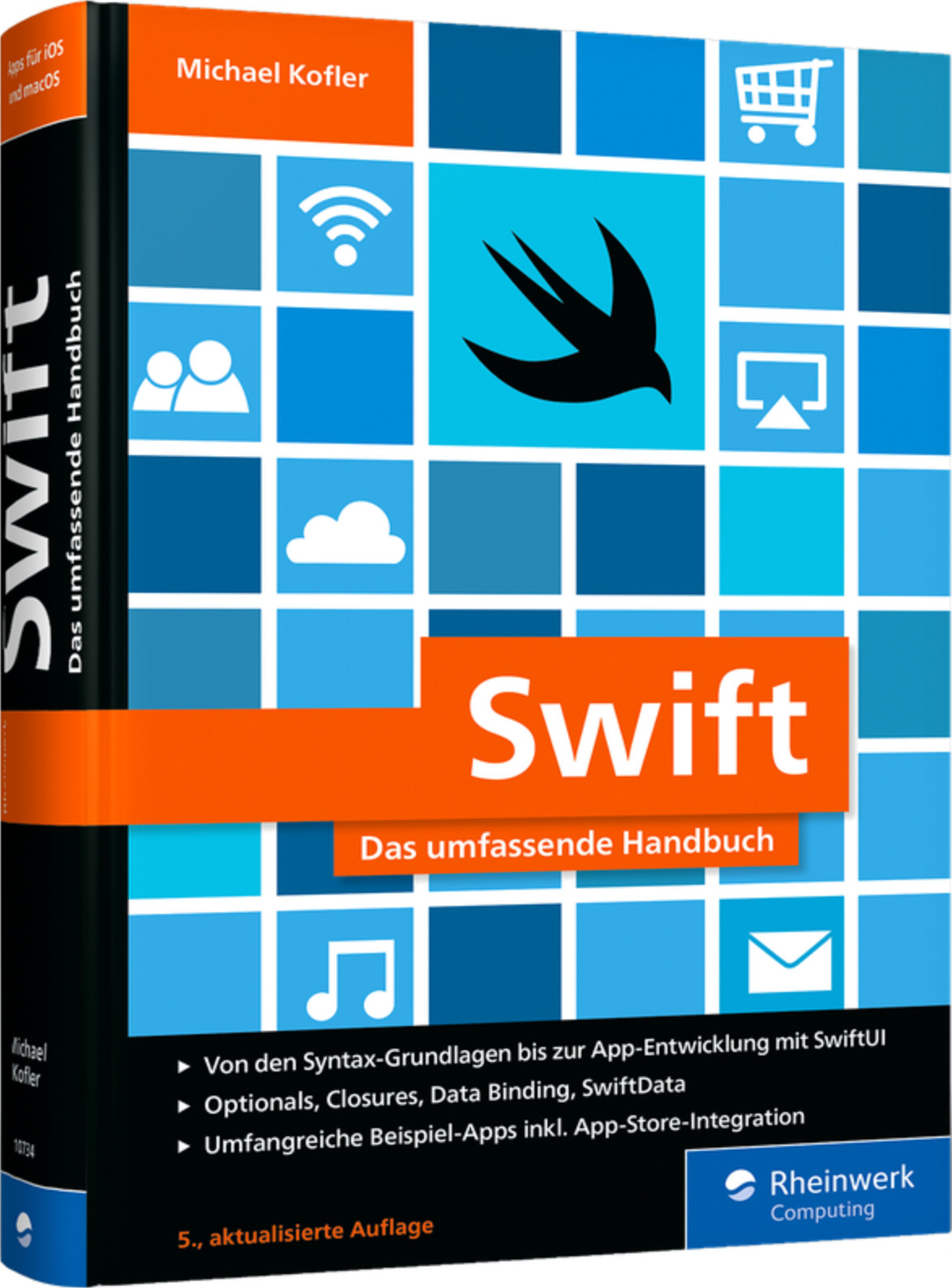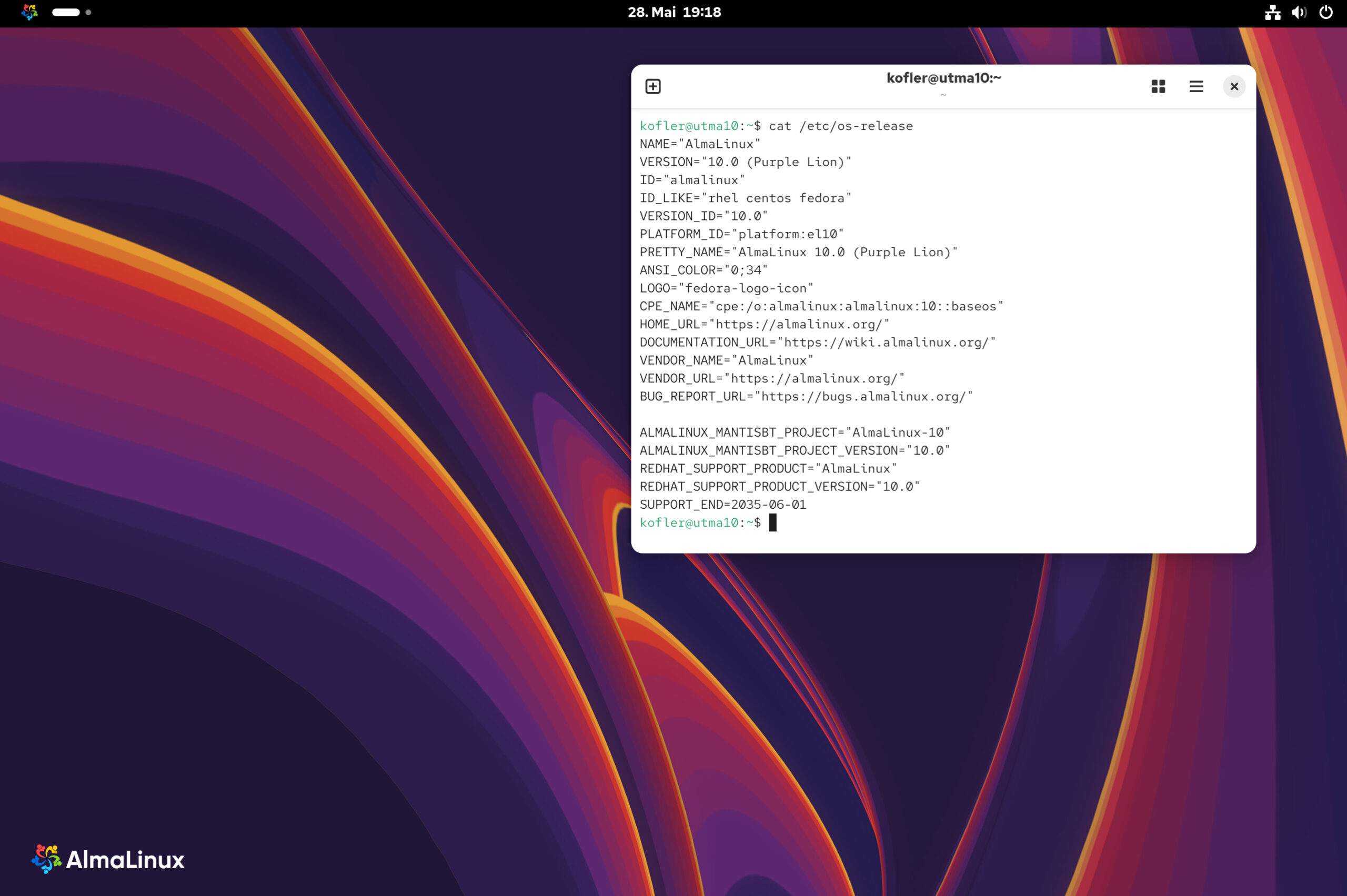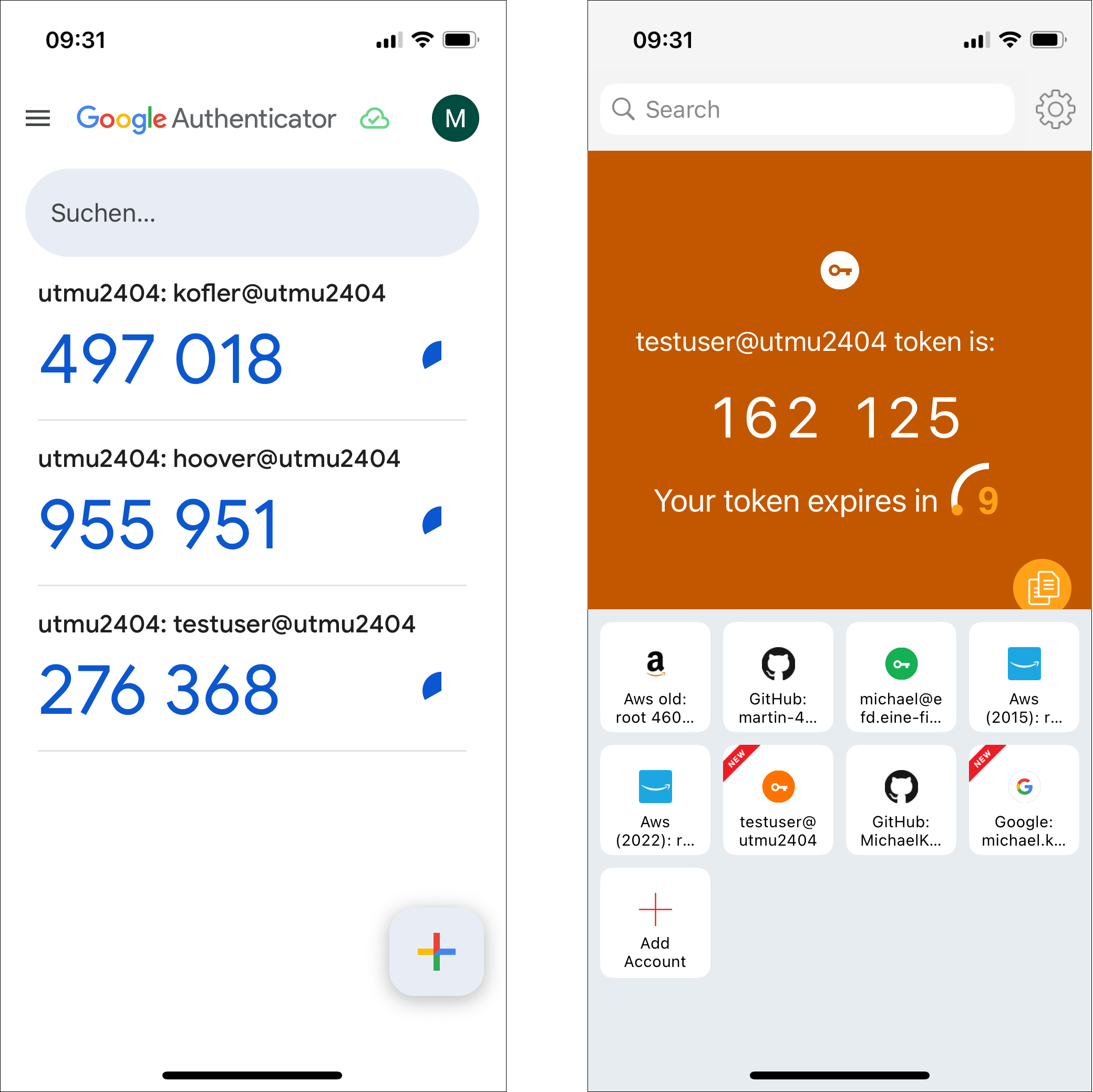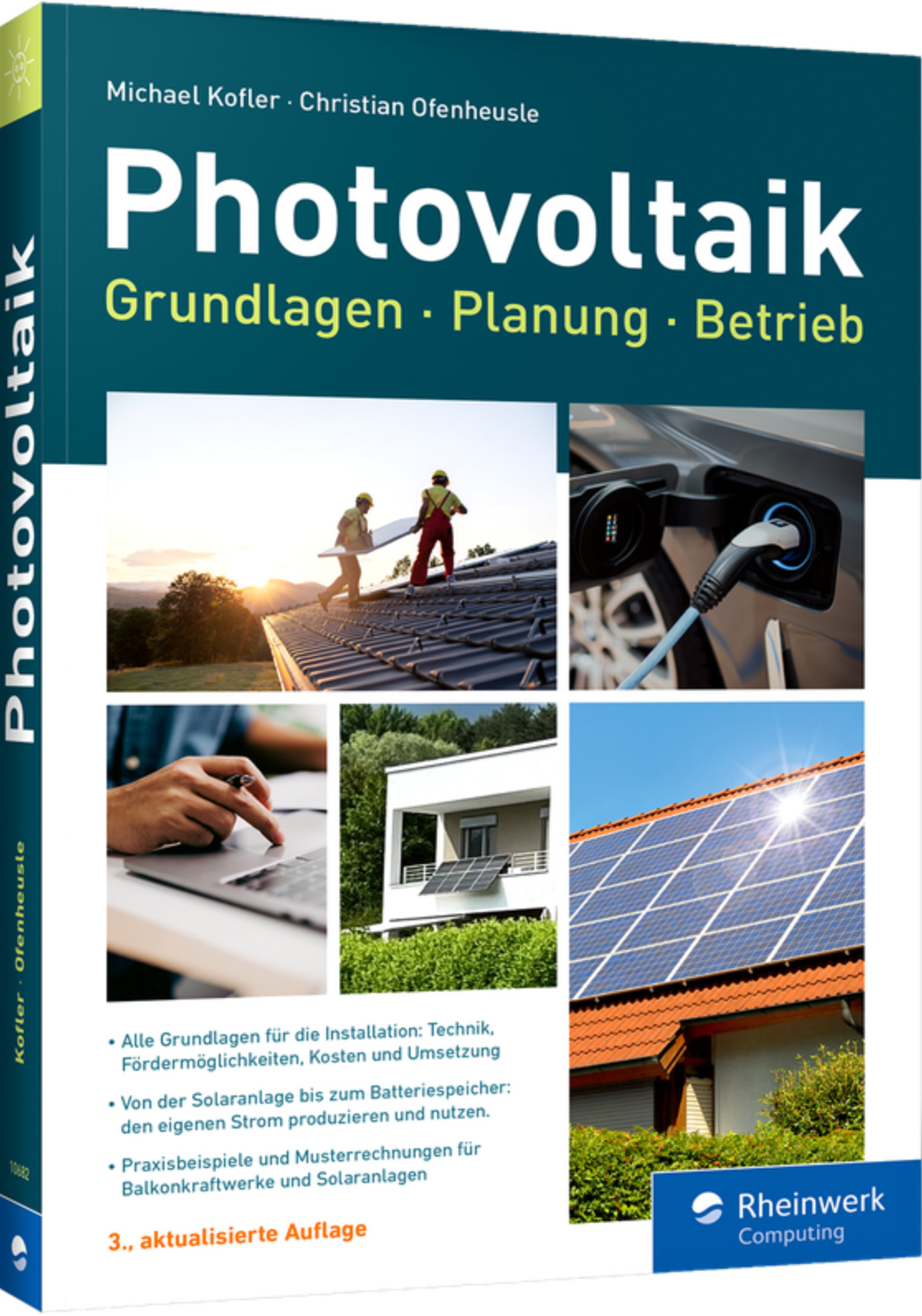Eine Weile hat es so ausgesehen, als wäre »Swift 5« die letzte Auflage meiner Swift-Bücher. Um so mehr freut es mich, dass »Swift — Das umfassenden Handbuch« diese Woche rundumerneuert erschienen ist! Auch wenn der Verlag von der 5. Auflage spricht — aus meiner Sicht ist das Buch praktisch komplett neu. Aus der vorigen Auflage habe ich eigentlich nur einige Grundlagenkapitel übernommen (und aktualisiert), die die Syntax von Swift beschreiben.
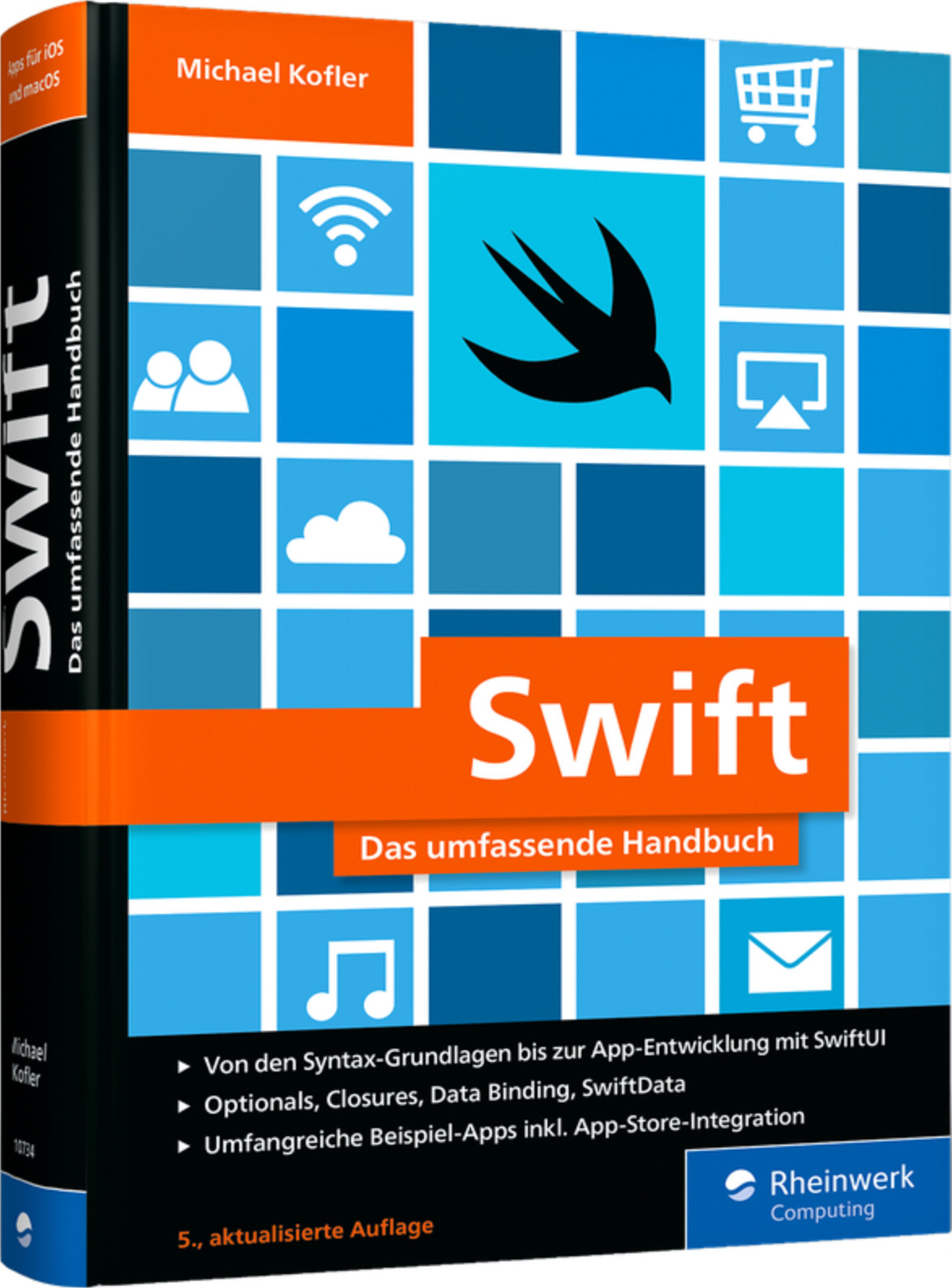
Vollkommen neu ist hingegen der Fokus auf SwiftUI. Diese Bibliothek wird längerfristig das UIKit ablösen. SwiftUI erfordert in vielerlei Hinsicht ein Neulernen der UI-Programmierung. Der Aufwand lohnt sich! UIKit funktioniert plattformübergreifend (macOS, iOS etc.), passt sich automatisch an den Dark Mode an, übernimmt die Font-Einstellungen aus den Systemeinstellungen usw. Endlich könnenSie die Oberflächen Ihrer Apps per Code gestalten und sind nicht auf den unübersichtlichen Story-Board-Editor angewiesen.
Geändert hat sich das Buch auch aus einem zweiten Grund: Als ich die vorige Auflage verfasst habe, gab es ChatGPT noch nicht. Mit KI-Assistenten ändert sich der Coding-Alltag aber grundlegend. Sie müssen die Konzepte und Grundlagen verstehen; Details wie die Reihenfolge der Optionen, die Syntax exotischer Klassen etc. können Sie hingegen getrost KI-Tools überlassen. Mit etwas Glück werden brauchbare KI-Werkzeuge demnächst auch in Xcode integriert. (Diesbezüglich hat Apple viel versprochen, aber bisher wenig geliefert.) Bis es so weit ist, liefern auch ChatGPT, Claude oder Gemini verblüffend gute Code-Vorschläge.
Kurz und gut: »Swift — Das umfassende Handbuch« vermittelt Ihnen das Fundament, um selbstständig oder mit KI-Unterstützung eigene Apps zu entwickeln. Mehr Details zum Buch können Sie hier nachlesen:
https://kofler.info/buecher/swift/