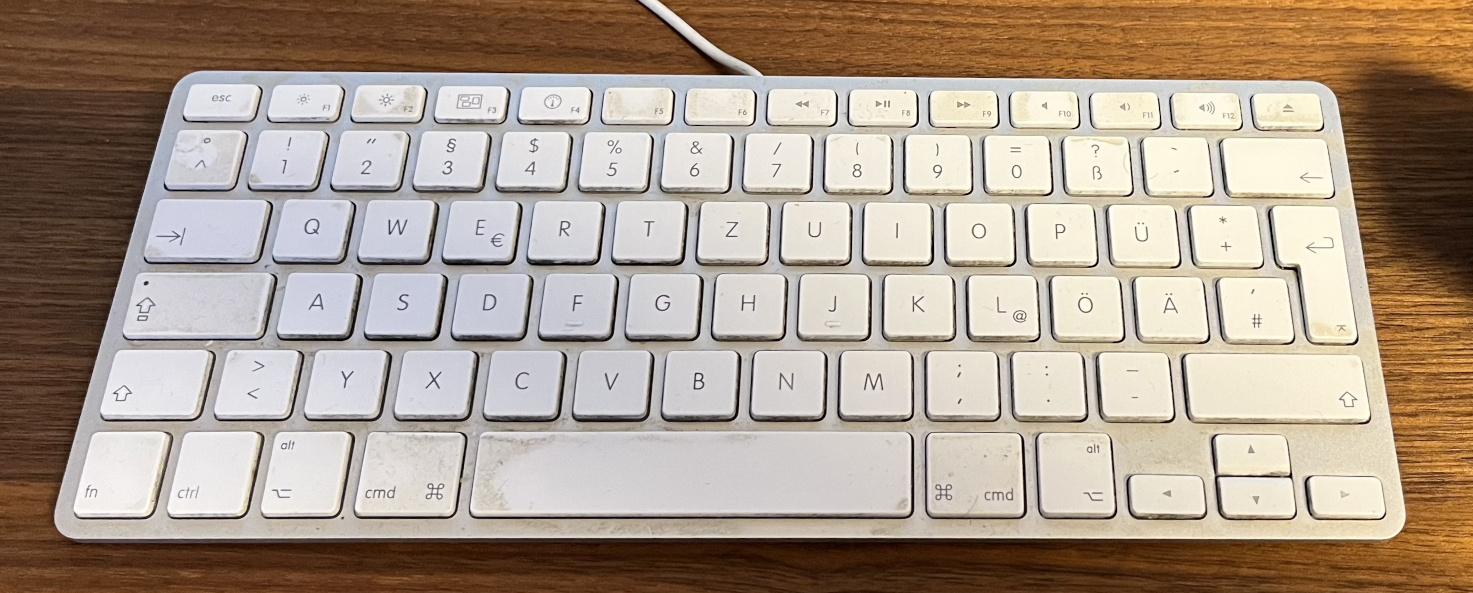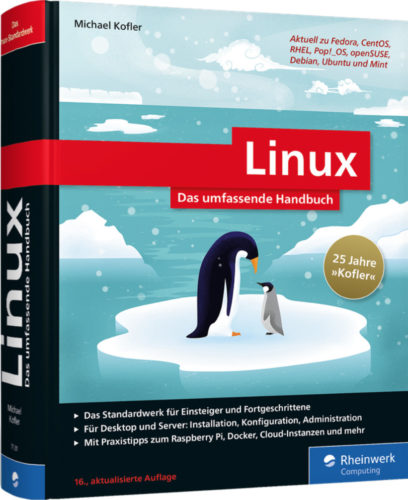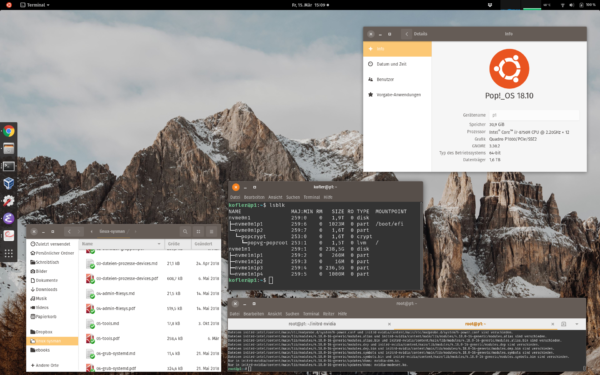Seit vielen Jahren verwende ich Let’s Encrypt-Zertifikate für meine Webserver. Zum Ausstellen der Zertifikate habe ich in den Anfangszeiten das Kommando certbot genutzt. Weil die Installation dieses Python-Scripts aber oft Probleme bereitete, bin ich schon vor vielen Jahren auf das Shell-Script acme.sh umgestiegen (siehe https://github.com/acmesh-official/acme.sh).
Kürzlich bin ich auf einen Sonderfall gestoßen, bei dem acme.sh nicht auf Anhieb funktioniert. Die Kurzfassung: Ich verwende Apache als Proxy für eine REST-API, die in einem Docker-Container läuft. Bei der Zertifikatausstellung/-erneuerung ist Apache (der auf dem Rechner auch als regulärer Webserver läuft) im Weg; die REST-API liefert wiederum keine statischen Dateien aus. Die Domain-Verifizierung scheitert. Abhilfe schafft eine etwas umständliche Apache-Konfiguration.