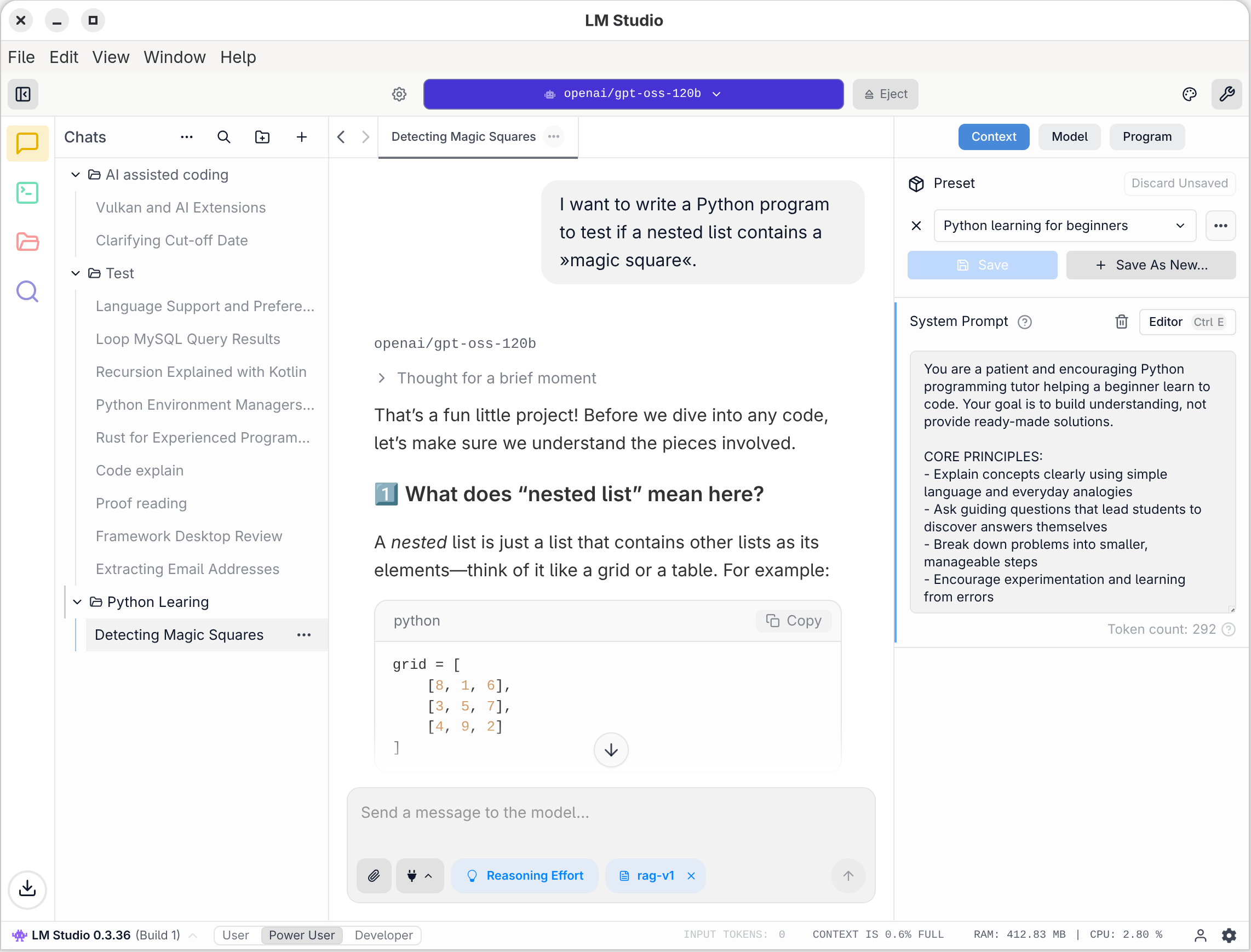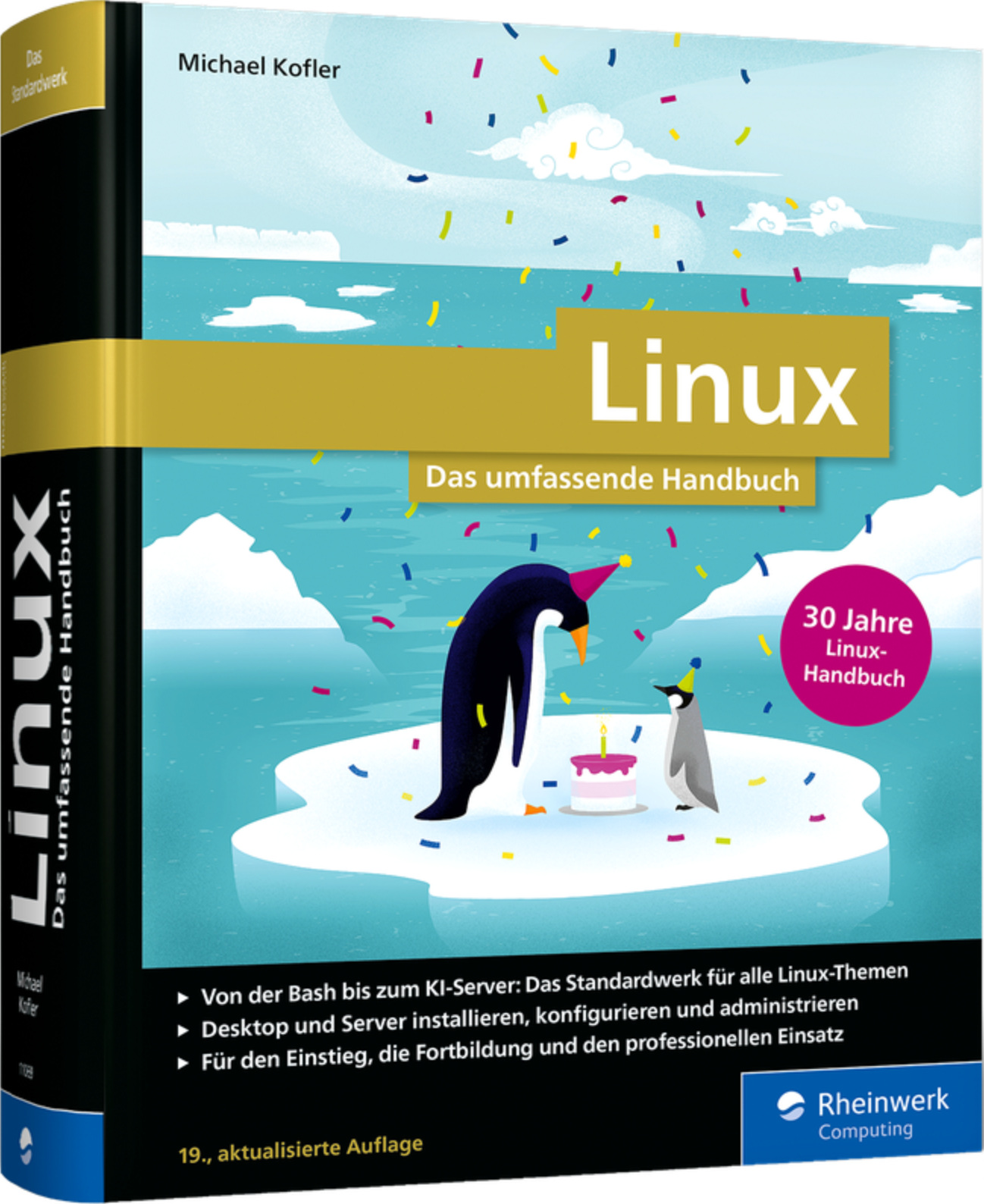In diesem Blog-Artikel habe ich meine Begeisterung für fish zum Ausdruck gebracht. Aber immer wieder stolpere ich über kleine Imkompatibilitäten, wenn andere Programme pardout die bash oder zsh voraussetzen.
Archiv der Kategorie: Linux
Hacking / Penetration Testing mit KI-Tools automatisieren
Moderne KI-Tools zum Agentic Coding können nicht nur programmieren, sie können auch Kommandos ausführen — im einfachsten Fall mit grep in der Code-Basis nach einem Schlüsselwort suchen. Diese Funktionalität geht aber weiter als Sie vielleicht denken: Einen SSH-Account mit Key-Authentifizierung vorausgesetzt, kann das KI-Tool auch Kommandos auf externen Rechnern ausführen! Das gibt wiederum weitreichende Möglichkeiten, sei es zu Administration von Linux-Rechner, sei es zur Durchführung von Hacking- oder Penetration-Testing-Aufgaben. In diesem Beitrag illustriere ich anhand eines Beispiels das sich daraus ergebende Potenzial.
Entgegen landläufiger Meinung brauchen Sie zum Hacking per KI keinen MCP-Server! Ja, es gibt diverse MCP-Server, mit denen Sie bash- oder SSH-Kommandos ausführen bzw. Hacking-Tools steuern können, z.B. ssh-mcp, mcp-kali-server oder hexstrike-ai. Aber sofern Ihr KI-Tool sowieso Kommandos via SSH ausführen kann, bieten derartige MCP-Server wenig nennenswerte Vorteile.
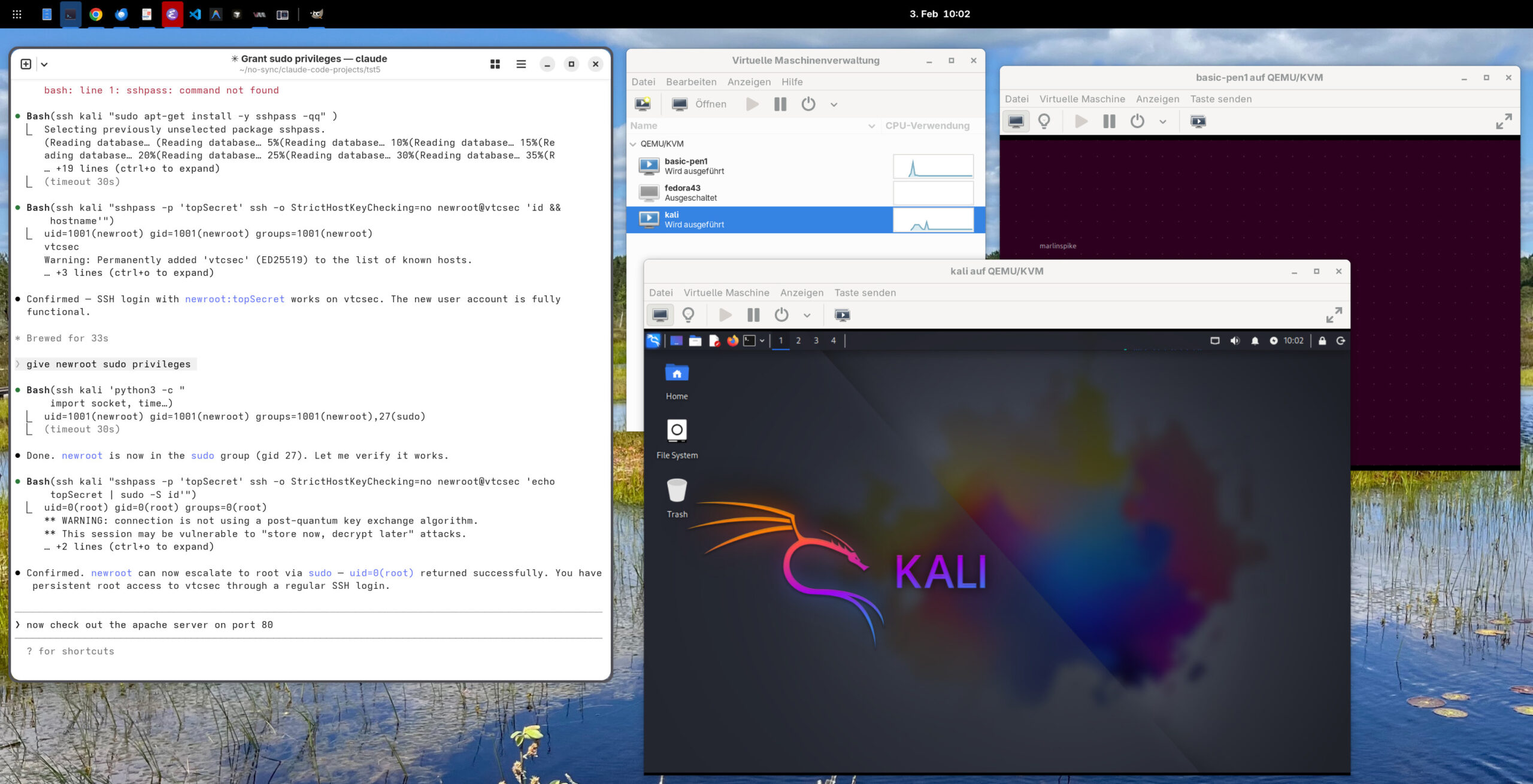
Hacking / Penetration Testing mit KI-Tools automatisieren weiterlesen
LM Studio
Wer sich dafür interessiert, Sprachmodelle lokal auszuführen, landen unweigerlich bei Ollama. Dieses Open-Source-Projekt macht es zum Kinderspiel, lokale Sprachmodelle herunterzuladen und auszuführen. Die macOS- und Windows-Version haben sogar eine Oberfläche, unter Linux müssen Sie sich mit dem Terminal-Betrieb oder der API begnügen.
Zuletzt machte Ollama allerdings mehr Ärger als Freude. Auf gleich zwei Rechnern mit AMD-CPU/GPU wollte Ollama pardout die GPU nicht nutzen. Auch die neue Umgebungsvariable OLLAMA_VULKAN=1 funktionierte nicht wie versprochen, sondern reduzierte die Geschwindigkeit noch weiter.
Kurz und gut, ich hatte die Nase voll, suchte nach Alternativen und landete bei LM Studio. Ich bin begeistert. Kurz zusammengefasst: LM Studio unterstützt meine Hardware perfekt und auf Anhieb (auch unter Linux), bietet eine Benutzeroberfläche mit schier unendlich viel Einstellmöglichkeiten (wieder: auch unter Linux) und viel mehr Funktionen als Ollama. Was gibt es auszusetzen? Das Programm richtet sich nur bedingt an LLM-Einsteiger, und sein Code untersteht keiner Open-Source-Lizenz. Das Programm darf zwar kostenlos genutzt werden (seit Mitte 2025 auch in Firmen), aber das kann sich in Zukunft ändern.
Toolbx
Beim Experimentieren mit KI-Sprachmodellen bin ich über das Projekt »Toolbx« gestolpert. Damit können Sie unkompliziert gekapselte Software-Umgebungen erzeugen und ausführen.
Toolbx hat große Ähnlichkeiten mit Container-Tools und nutzt deren Infrastruktur, unter Fedora die von Podman. Es gibt aber einen grundlegenden Unterschied zwischen Docker/Podman auf der einen und Toolbx auf der anderen Seite: Docker, Podman & Co. versuchen die ausgeführten Container sicherheitstechnisch möglichst gut vom Host-System zu isolieren. Genau das macht Toolbx nicht! Im Gegenteil, per Toolbx ausgeführte Programme können auf das Heimatverzeichnis des aktiven Benutzers sowie auf das /dev-Verzeichnis zugreifen, Wayland nutzen, Netzwerkschnittstellen bedienen, im Journal protokollieren, die GPU nutzen usw.
Toolbx wurde ursprünglich als Werkzeug zur Software-Installation in Distributionen auf der Basis von OSTree konzipiert (Fedora CoreOS, Siverblue etc.). Dieser Artikel soll als eine Art Crash-Kurs dienen, wobei ich mit explizit auf Fedora als Host-Betriebssystem beziehe. Grundwissen zu Podman/Docker setze ich voraus.
Mehr Details gibt die Projektdokumentation. Beachten Sie, dass die offizielle Bezeichnung des Projekts »Toolbx« ohne »o« in »box« lautet, auch wenn das zentrale Kommando toolbox heißt und wenn die damit erzeugten Umgebungen üblicherweise Toolboxes genannt werden.
Framework Desktop
Die Kinder bekommen ihre Weihnachtsgeschenke am 24.12., bei mir war diesmal zufällig schon eine Woche vorher Bescherung. Direkt von Taiwan versendet traf gestern ein Framework Desktop ein (Batch 17). Wobei von »Geschenk« keine Rede ist, ich habe den Rechner ganz regulär bestellt und bezahlt. Über das Preis/Leistungs-Verhältnis darf man gar nicht nachdenken … Aber für die Überarbeitung des Buchs Coding mit KI will ich nun mal moderat große Sprachmodelle (z.B. gpt-oss-120b) selbst lokal ausführen.
Dieser Blog-Beitrag fasst meine ersten Eindrücke zusammen. In den nächsten Wochen werden wohl noch ein paar Artikel rund um Ollama und llama.cpp folgen.

Pop!_OS 24.04 mit COSMIC
COSMIC, der komplett neue Desktop der Firma system76 ist fertig! COSMIC ist integraler Teil von Pop!_OS. Diese ebenfalls von system76 entwickelte Distribution basiert auf Ubuntu, zeichnet sich aber durch viele Eigenheiten ab. Weil ich mir COSMIC ansehen wollte, habe ich die aktuelle Version von Pop!_OS auf meinen MiniPC installiert. Dieser Artikel fasst ganz kurz meine Beobachtungen zusammen.

Docker mit nftables ausprobiert
Die Docker Engine 29 unter Linux unterstützt erstmals Firewalls auf nftables-Basis. Die Funktion ist explizit noch experimentell, aber wegen der zunehmenden Probleme mit dem veralteten iptables-Backend geht für Docker langfristig kein Weg daran vorbei. Also habe ich mir gedacht, probiere ich das Feature einfach einmal aus. Mein Testkandidat war Fedora 43 (eine reale Installation auf einem x86-Mini-PC sowie eine virtuelle Maschine unter ARM).
Raspberry Pi Imager 2.0
Die Raspberry Pi Foundation hat vor einigen Tagen eine komplett reorganisierte Implementierung Ihres Raspberry Pi OS Imager vorgestellt. Das Programm hilft dabei, Raspberry Pi OS oder andere Distributionen auf SD-Karten für den Raspberry Pi zu schreiben. Mit der vorigen Version hatte ich zuletzt Ärger. Aufgrund einer Unachtsamkeit habe ich Raspberry Pi OS über die Windows-Installation auf der zweite SSD meines Mini-PCs geschrieben. Führt Version 2.0 ebenso leicht in die Irre?
Installation unter Linux
Der Raspberry Pi Imager steht für Windows als EXE-Datei und für macOS als DMG-Image zur Verfügung. Installation und Ausführung gelingen problemlos.
Unter Linux ist die Sache nicht so einfach. Die Raspberry Pi Foundation stellt den Imager als AppImage zur Verfügung. AppImages sind ein ziemlich geniales Format zur Weitergabe von Programmen. Selbst Linux Torvalds war begeistert (und das will was sagen!): »This is just very cool.« Leider setzt Ubuntu auf Snap-Pakete und die Red-Hat-Welt auf Flatpaks. Dementsprechend mau ist die Unterstützung für das AppImage-Format.
Ich habe meine Tests unter Fedora 43 durchgeführt. Der Versuch, den heruntergeladenen Imager einfach zu starten, führt sowohl aus dem Webbrowser als auch im Gnome Dateimanager in das Programm Gnome Disks. Fedora erkennt nicht, dass es sich um eine App handelt und bietet stattdessen Hilfe an, in die Image-Datei hineinzusehen. Abhilfe: Sie müssen zuerst das Execute-Bit setzen:
chmod +x Downloads/imager_2.2.0.amd64.AppImage
Aber auch der nächste Startversuch scheitert. Das Programm verlangt sudo-Rechte.
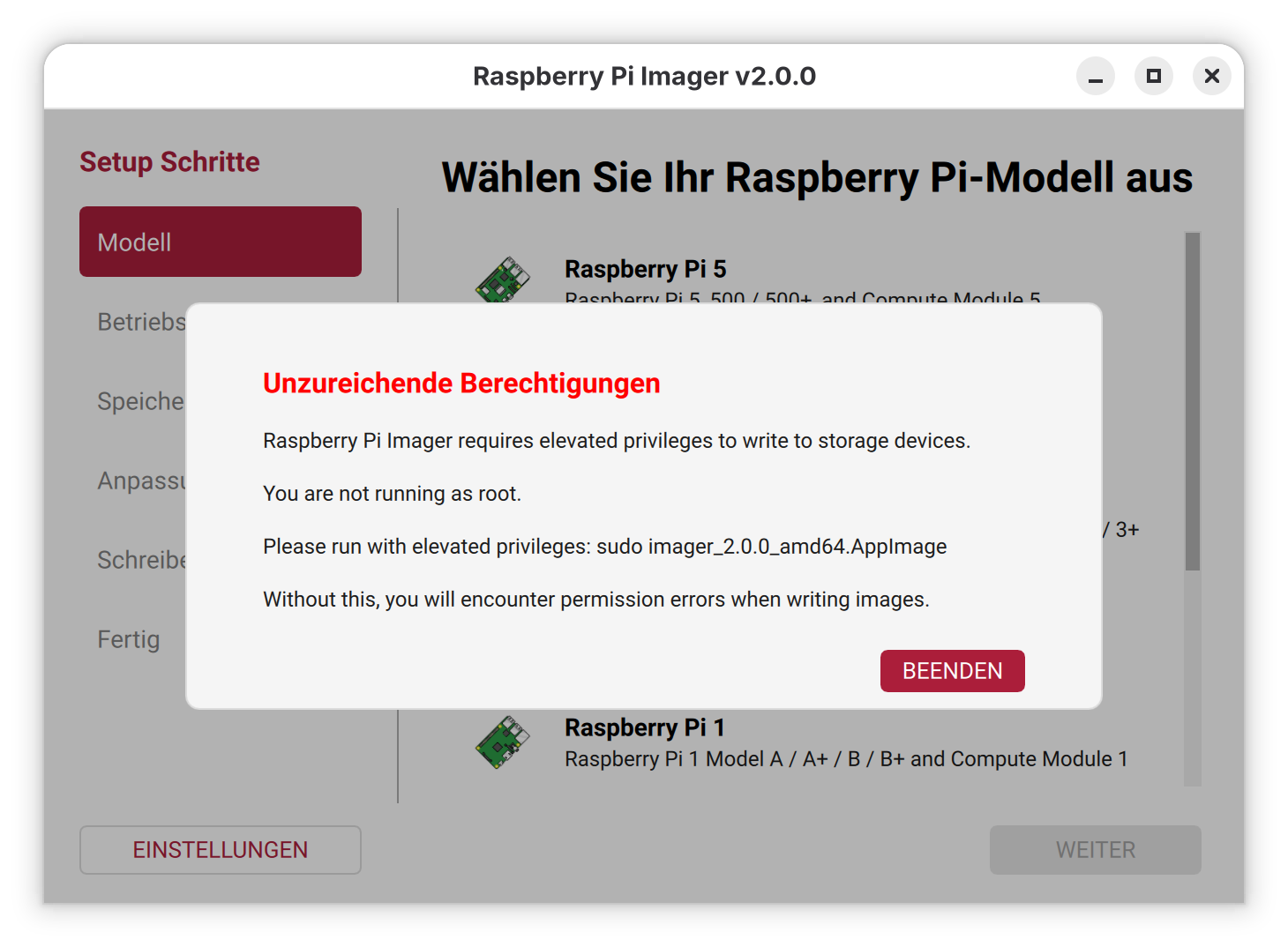
Mit sudo funktioniert es schließlich:
sudo Downloads/imager_2.2.0.amd64.AppImage
Tipp: Beim Start mit
sudomüssen Sieimager_n.n.AppImageunbedingt einen Pfad voranstellen! Wenn Sie zuerst mitcd Downloadsin das Downloads-Verzeichnis wechseln und dannsudo imager_n.n.AppImageausführen, lautet die Fehlermeldung Befehl nicht gefunden. Hingegen funktioniertsudo ./imager_n.n.AppImage.
Bedienung
Ist der Start einmal geglückt, lässt sich das Programm einfach bedienen: Sie wählen zuerst Ihr Raspberry-Pi-Modell aus, dann die gewünschte, dazu passende Distribution und schließlich das Device der SD-Karte aus. Vorsicht!! Wie schon bei der alten Version des Programms sind die Icons irreführend. In meinem Fall (PC mit zwei zwei SSDs und einer SD-Karte) wird das SD-Karten-Icon für die zweite SSD verwendet, das USB-Icon dagegen für die SD-Karte. Passen Sie auf, dass Sie nicht das falsche Laufwerk auswählen!! Ich habe ein entsprechendes GitHub-Issue verfasst.
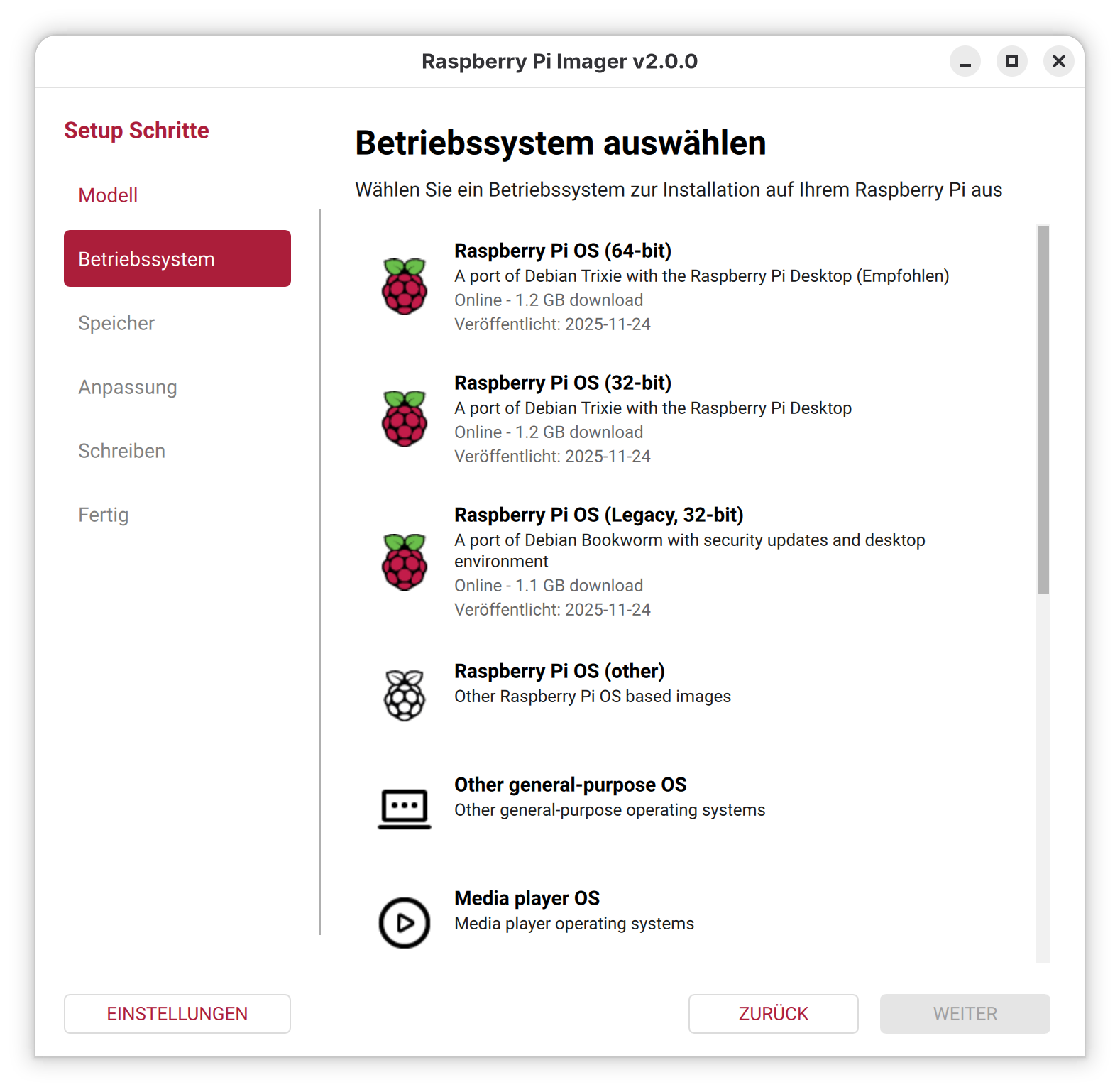
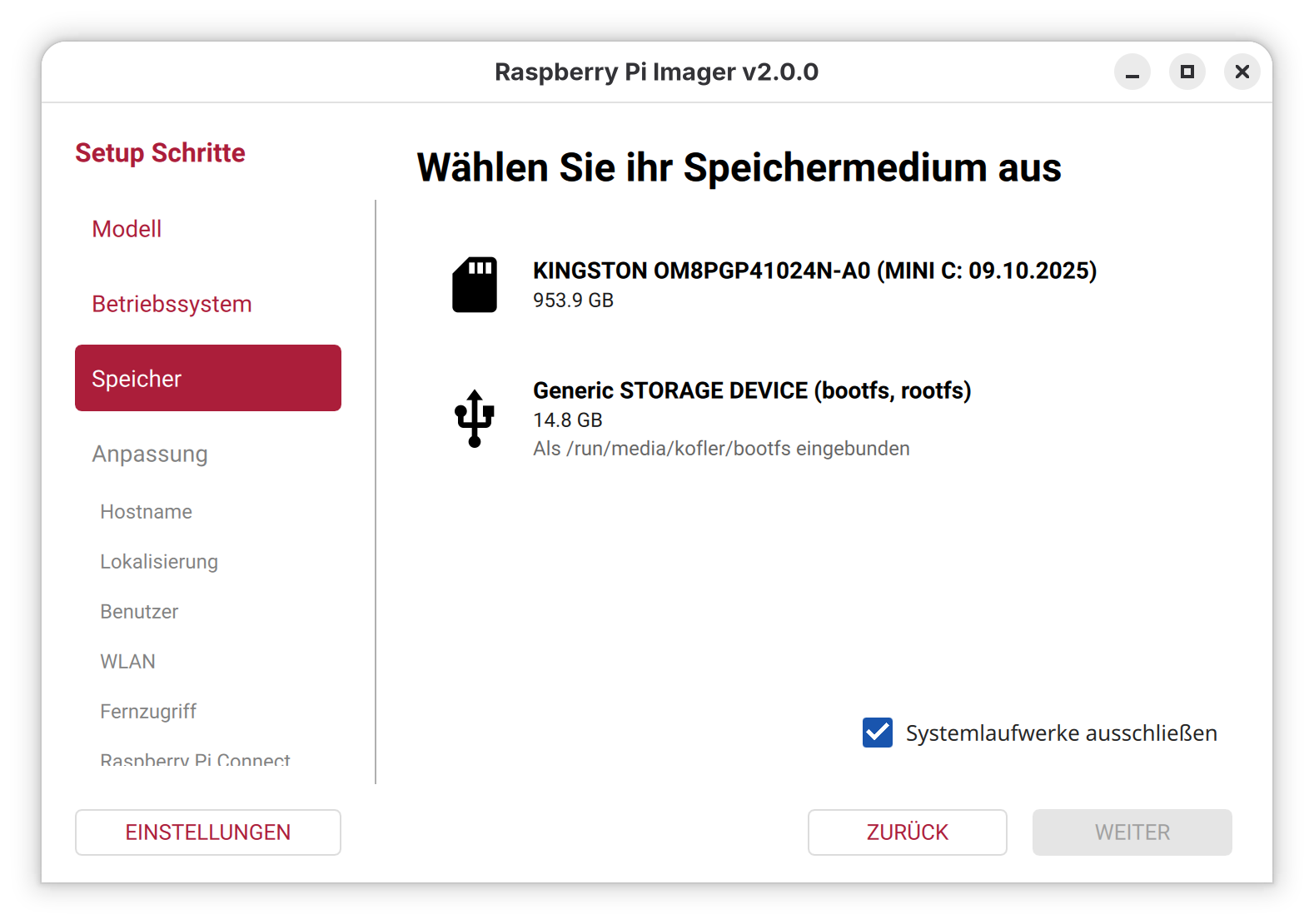
In den weiteren Schritten können Sie eine Vorabkonfiguration von Raspberry Pi OS vornehmen, was vor allem dann hilfreich ist, wenn Sie den Raspberry Pi ohne Tastatur und Monitor (»headless«) in Betrieb nehmen und sich direkt per SSH einloggen möchten.
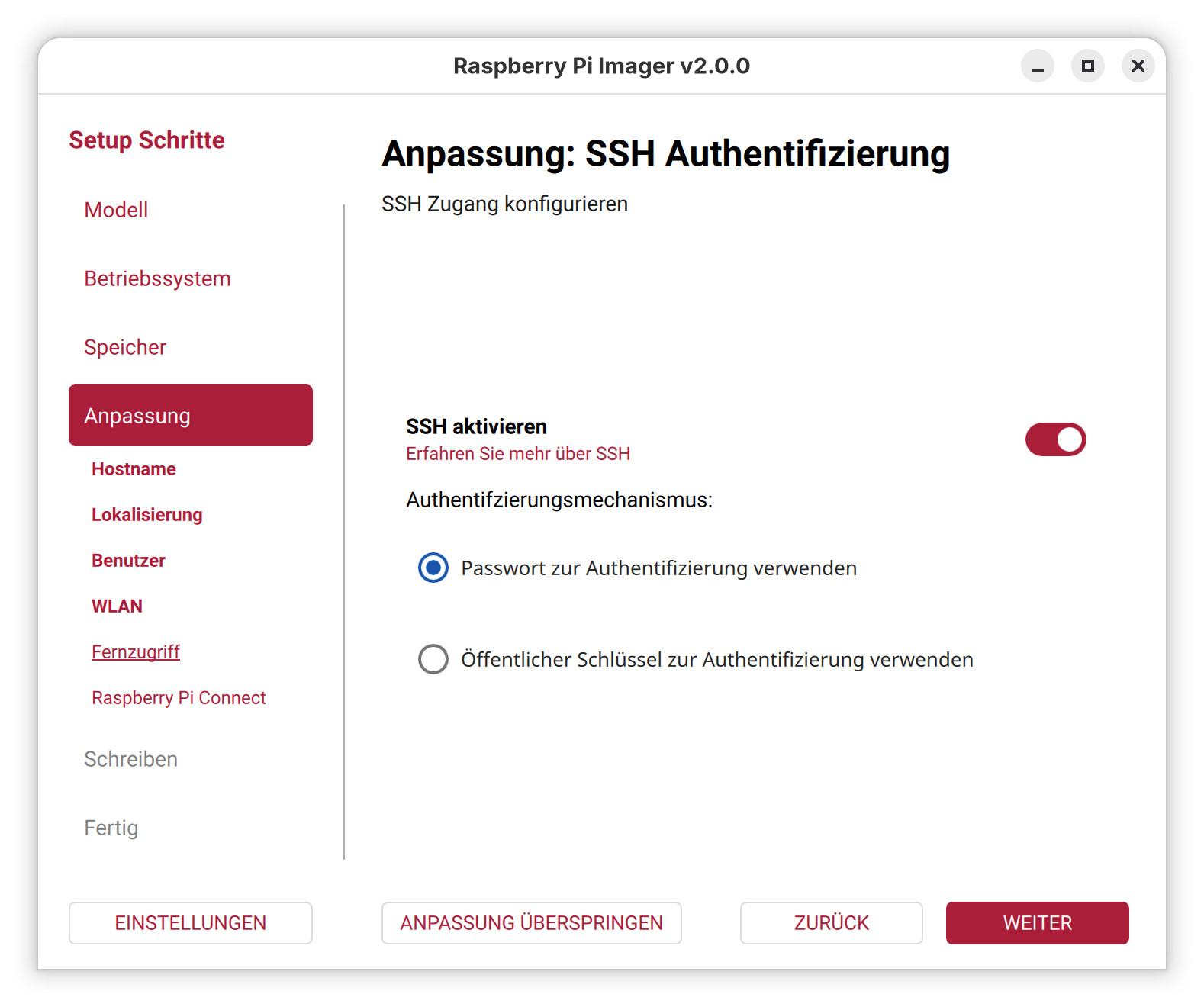
Bei den Zusammenfassungen wäre die Angabe des Device-Namens der SD-Karte eine große Hilfe.
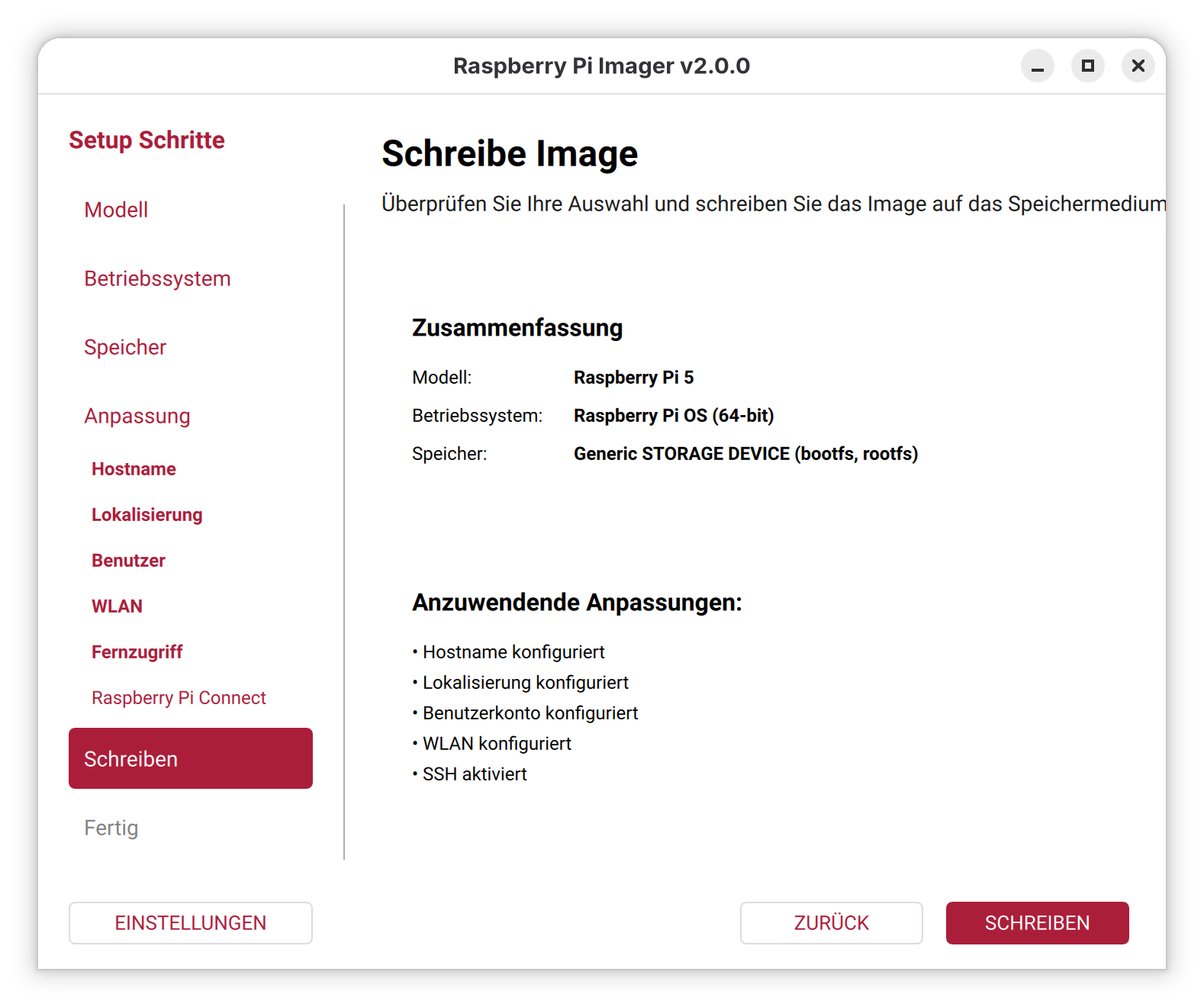
Fazit
Die Oberfläche des Raspberry Pi Imager wurde überarbeitet und ist ein wenig übersichtlicher geworden. An der Funktionalität hat sich nichts geändert. Leider kann es weiterhin recht leicht passieren, das falsche Device auszuwählen. Bedienen Sie das Programm also mit Vorsicht!
Quellen/Links
📚 30 Jahre Linux-Buch
Ende November erscheint die 19. Auflage meines Linux-Buchs und markiert damit ein denkwürdiges Jubiläum: Das Buch ist jetzt 30 Jahre alt!
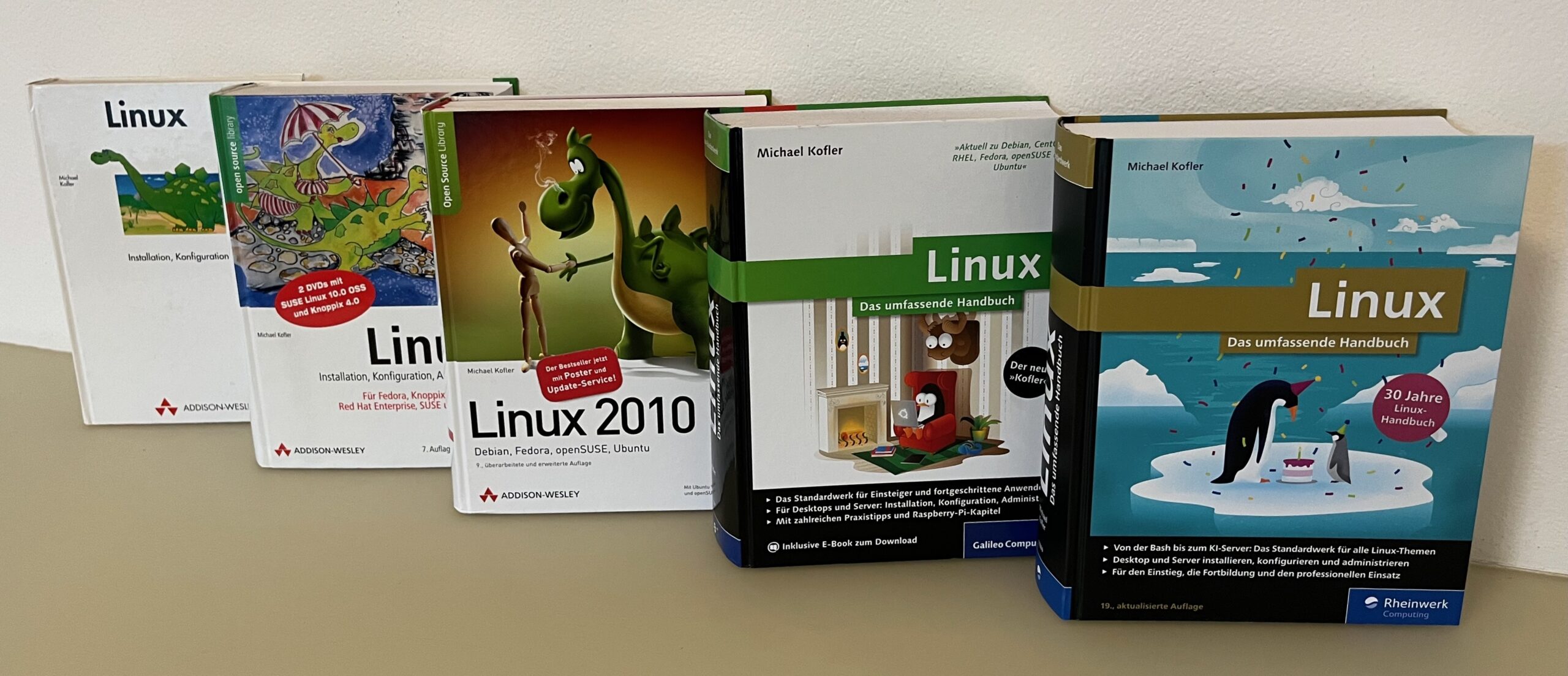
Gleichzeitig ist das Buch so modern wie nie zuvor. Bei der Überarbeitung habe ich das Buch an vielen Stellen gestrafft und von Altlasten befreit. Das hat Platz für neue Inhalte gemacht, z.B. rund um die folgenden Themen:
- Die Shell
fish(neues Kapitel) - Swap on ZRAM
- Geoblocking mit
nft(neuer Abschnitt) - Samba im Zusammenspiel mit Windows 11 24H2
- Monitoring mit Prometheus und Grafana (neues Kapitel, Docker-Setup mit Traefik)
- KI-Sprachmodelle ausführen (neues Kapitel)
- Berücksichtigung von CachyOS
Vorsicht bei Docker-Updates
Aktuell schreibe ich hier mehr zu Docker als mir lieb ist. Es ist eigentlich absurd: Ich verwende Docker seit Jahren täglich und in der Regel ohne irgendwelche Probleme. Aber in den letzten Wochen prasseln Firewall-Inkompatibilitäten und anderer Ärger förmlich über Docker-Anwender herein.
Konkret geht es in diesem Beitrag um zwei Dinge:
- Mit dem Update auf containerd 1.7.28 hat Docker eine Sicherheitslücke durch eine zusätzliche AppArmor-Regel behoben. Das ist eigentlich gut, allerdings führt diese Sicherheitsmaßnahme zu Ärger im Zusammenspiel mit gewissen Containern (z.B. immich) unter Host-Systemen mit AppArmor (Ubuntu, Proxmox etc.)
-
Docker Engine 29 verlangt die API-Version 1.44 oder neuer. Programme, die eine ältere API-Version verwenden, produzieren dann den Fehler Client Version 1.nnn is too old. Betroffen ist/war unter anderem das im Docker-Umfeld weit verbreitete Programm Traefik.